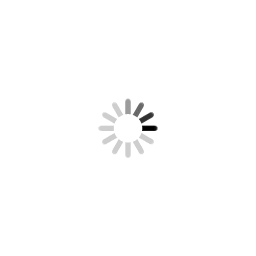Text aus dem Indikatorenbericht 2022
Die Daten stammen aus der Todesursachenstatistik und der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamtes. Alle amtlichen Todesbescheinigungen werden im Rahmen der Todesursachenstatistik erfasst und ausgewertet. Die aktuellen Bevölkerungszahlen gibt die Bevölkerungsfortschreibung basierend auf den Ergebnissen der jeweiligen letzten Volkszählung an. Um einen Vergleich von Veränderungsraten über die Zeit zu ermöglichen, beziehen sich die Daten auf die alte Europastandardbevölkerung. Hierbei handelt es sich um eine Modellbevölkerung.
Die Indikatoren 3.1.a und 3.1.b werden auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (www.gbe-bund.de) zur Verfügung gestellt. Die Säuglingssterblichkeit (unter 1-Jährige) wird nicht betrachtet.
Zwischen 1991 und 2020 ist die vorzeitige Sterblichkeit bei Frauen (‒38 %) und Männern (‒44 %) stetig zurückgegangen. Durch den stärkeren Rückgang bei Männern hat sich auch der geschlechtsspezifische Unterschied der vorzeitigen Sterblichkeit verringert. 145 Frauen und 276 Männer je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner starben im Jahr 2020 bevor sie das 70. Lebensjahr vollendeten. Die geschlechtsspezifischen Zielwerte für das Jahr 2030 würden jedoch bei gleichbleibender Entwicklung, wie in den vergangenen Jahren, verfehlt werden.
Im Zeitverlauf der Indikatoren spiegeln sich die insgesamt deutlich erhöhten Sterbefälle aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 kaum wider. Während die Sterblichkeit bei den hier nicht betrachteten über 80-Jährigen in 2020 deutlich angestiegen ist, lag der Anteil von COVID-19 an den Todesursachen in der hier betrachteten Altersklasse bei 1,7 % bei den Frauen und 2,3 % bei den Männern, sodass die Indikatoren durch die COVID-19-Pandemie wenig beeinflusst wurden. Es wird dabei davon ausgegangen, dass es zu keiner wesentlichen Untererfassung der COVID-19-Todesfälle kam.
Die Lebenserwartung ist ein Indikator, der auf Grundlage der Statistik der Sterbefälle und der Bevölkerungsfortschreibung berechnet wird und Effekte der Bevölkerungsalterung auf die Entwicklung der Sterblichkeit herausrechnet. Im Zuge der Pandemie kam es zu einem kurzfristigen Rückgang der Lebenserwartung in den Jahren 2020 und 2021. Langfristig gesehen hat sich die Lebenserwartung in Deutschland, entsprechend dem insgesamt stetigen Rückgang der vorzeitigen Sterblichkeit, weiter positiv entwickelt. Mit 17,0 weiteren Lebensjahren können statistisch gesehen heute 70-jährige Frauen rechnen, Männer mit weiteren 14,3 Jahren. In den Jahren 2019 bis 2021 betrug die mittlere Lebenserwartung für neugeborene Mädchen 83,4 Jahre und für Jungen 78,5 Jahre. Sie liegt damit für Mädchen um 4,4 Jahre und für Jungen um 6,1 Jahre höher als in den Jahren 1991 bis 1993. Die in der Vergangenheit ausgeprägten Differenzen bei der Lebenserwartung zwischen dem früheren Bundesgebiet und den neuen Bundesländern (jeweils ohne Berlin) haben sich langfristig betrachtet deutlich reduziert und betragen heute bei neugeborenen Jungen 1,8 und bei neugeborenen Mädchen 0,2 Jahre. Während der Pandemie sind die Ost-West-Unterschiede dabei allerdings wieder größer geworden.
Bösartige Neubildungen hatten im Jahr 2020 an allen Ursachen der vorzeitigen Sterblichkeit mit 35,9 % (1991 bis 2020: +2,7 Prozentpunkte) den größten Anteil, gefolgt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 19,5 % (1991 bis 2020: ‒11,6 Prozentpunkte). Zur vorzeitigen Sterblichkeit trugen weiter Todesfälle aufgrund äußerer Ursachen (wie Unfälle, Vergiftungen, Suizid) mit 8,6 % (1991 bis 2020: ‒2,4 Prozentpunkte), Krankheiten des Verdauungssystems mit 7,3 % (1991 bis 2020: ‒0,3 Prozentpunkte) und Krankheiten des Atmungssystems mit 5,2 % (1991 bis 2020: +1,2 Prozentpunkte) bei.
Neben Faktoren wie zum Beispiel dem Gesundheitsverhalten (siehe „Raucherquoten“ Indikatoren 3.1.c und 3.1.d sowie „Adipositasquoten“ Indikatoren 3.1.e und 3.1.f) spielt für die Sterblichkeit auch die medizinische Versorgung eine wichtige Rolle. Die Gesundheitsausgaben stiegen im Corona-Jahr 2020 auf einen neuen Höchststand von 440,6 Milliarden Euro. Je Einwohnerin und Einwohner waren das 5 298 Euro (2019: 4 980 Euro). Die Gesundheitsausgaben pro Kopf stiegen damit erstmals seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1992 auf einen Wert über 5 000 Euro. Die Gesundheitsausgaben betrugen 2020 insgesamt 26,8 Milliarden Euro und damit 6,5 % mehr als 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag 2020 bei 13,1 % und damit 1,2 Prozentpunkte höher als 2019.