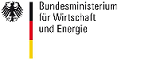7.2.b Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch
Die Berechnung des Indikators erfolgt durch die Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien Statistik (AGEE-Stat) auf Grundlage verschiedener amtlicher und nichtamtlicher Quellen. Der Bruttostromverbrauch (Nenner) umfasst die gesamte in Deutschland erzeugte und importierte Strommenge abzüglich der Stromexporte. Er umfasst somit die inländische Stromerzeugung, den grenzüberschreitenden Austauschsaldo, den Eigenstromverbrauch der Kraftwerke sowie die Netzverluste.
Im Zähler wird die in Deutschland erzeugte Strommenge aus erneuerbaren Energiequellen ausgewiesen. Dazu zählen Windenergie, Wasserkraft, solare Strahlungsenergie, Geothermie sowie Biomasse – einschließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas und Klärgas – sowie der biologisch abbaubare Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie.
Ein Anstieg des Indikators bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zugenommen hat. Der Wert des Indikators steigt auch dann, wenn beispielsweise die Stromexporte zunehmen, während die erzeugte Strommenge aus erneuerbaren Energieträgern konstant bleibt.
Eine weitere methodische Besonderheit ergibt sich bei der Behandlung von Speicherkraftwerken. Der Nenner des Indikators 7.2.b umfasst als Stromverbrauch sowohl deren Umwandlungseinsatz als auch den Verbrauch des Stroms, der von den Speicherkraftwerken erzeugt worden ist. Somit führt eine Stromspeicherung grundsätzlich zu einer Erhöhung des Nenners. Der von den Speicherkraftwerken erzeugte Strom wird aber grundsätzlich nicht zum Strom aus erneuerbaren Energiequellen gezählt – unabhängig davon, ob der ursprünglich zur Energiespeicherung eingesetzte Strom aus erneuerbaren Quellen stammte oder nicht.
Somit führt eine Stromspeicherung rechnerisch zu einer Senkung des Anteils des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch.
Das im Energiekonzept der Bundesregierung für das Jahr 2020 formulierte Ziel, mindestens 35 % des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken, wurde bereits im Jahr 2017 erreicht. In den Folgejahren stieg der Anteil weiter an und erreichte im Jahr 2020 einen Wert von 45,5 %. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch gesetzliche Maßnahmen wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorangetrieben. Das EEG verpflichtet die Netzbetreiber unter anderem dazu, Strom aus erneuerbaren Energien vorrangig in das Netz einzuspeisen.
Im Jahr 2021 sank der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch auf 41,7 %, stieg jedoch in den darauffolgenden Jahren wieder an und erreichte im Jahr 2024 einen Wert von 54,4 %. Der vorübergehende Rückgang im Jahr 2021 ist auf einen gestiegenen Bruttostromverbrauch sowie eine witterungsbedingte Verringerung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen zurückführen.
Seit dem Jahr 2005 ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung beinahe kontinuierlich gestiegen, insbesondere durch den Ausbau von Windenergie, Biomasse und Photovoltaik. Zwischen 2005 und 2024 stand einem Rückgang der Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern eine um rund 220 Terawattstunden gesteigerte Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen gegenüber.
Die Stromerzeugung aus Windenergie – an Land und auf See – erhöhte sich dabei von 27,8 Terawattstunden im Jahr 2005 auf knapp 138,9 Terawattstunden im Jahr 2024. Davon entfielen im Jahr 2024 rund 26,1 Terawattstunden (etwa 19 % der gesamten Stromerzeugung aus Windenergie) auf die Windenergie auf See.
Die Stromerzeugung aus Photovoltaik stieg im selben Zeitraum deutlich an – von 1,3 Terawattstunden im Jahr 2005 auf 74,1 Terawattstunden im Jahr 2024. Auch die Stromerzeugung aus Biomasse hat sich im selben Zeitraum mehr als verdreifacht und erreichte 2024 einen Wert von 48,6 Terawattstunden.
Die Fortsetzung dieser Entwicklung hätte ausgereicht, um das ursprünglich angestrebte Ziel der Bundesregierung – bis 2030 einen Anteil von 65 % erneuerbarer Energien am Stromverbrauch zu erzielen – zu erreichen. Für das aktuell gültige Ziel von 80 % bis 2030 wäre jedoch ein deutlich höherer jährlicher Zuwachs erforderlich als im bisherigen Durchschnitt.
Der gleichzeitig zu erwartende Anstieg des Strombedarfs – beispielsweise für Elektromobilität oder Raumwärme – erschwert die Zielerreichung zusätzlich. Der Zubau von großen Batteriespeicherkraftwerken kann zwar dazu beitragen, den Strombedarf aus fossilen Energieträgern zu reduzieren. Im Indikator wird sich dies aber bedingt durch seine methodische Konzeption nur partiell als Anstieg ausdrücken.