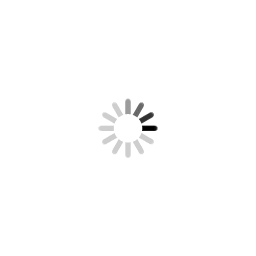Diese Übersicht beinhaltet zusätzliche Informationen zu den oben dargestellten Indikatoren, wie eine kurze Definition des Indikators und eine Beschreibung des politisch festgelegten Zielwertes sowie die politische Intention für die Auswahl des Indikators.
| Definition |
Der Indikator stellt den Anteil der Personen, die in Haushalten leben (in %) dar, der mehr als 40 % seines verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnen ausgibt. Ausgaben für Wohnen sind die Nettokaltmiete, Nebenkosten, Energiekosten und Ausgaben für Wasserversorgung sowie bei Wohneigentum werterhaltende Investitionen und Zinszahlungen für Kredite; nach staatlichen Entlastungsmaßnahmen wie Wohngeld oder vergleichbaren Sozialleistungen (z. B. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Grundsicherung). |
|---|---|
| Intention |
Hohe Wohnkosten führen dazu, dass Haushalte in ihren übrigen Konsumentscheidungen eingeschränkt werden. Ausgaben für Wohnen von mehr als 40 % des verfügbaren Haushaltseinkommens werden als Überlastung angesehen. |
| Ziel |
Senkung des Anteils der überlasteten Personen an der Bevölkerung auf 13 % bis 2030 |
| Art des Ziels |
Ziel mit konkretem Zielwert |
| Bewertung |
Zielformulierung: |
| Bewertung |