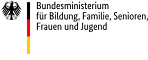5.1.b, c Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft sowie im öffentlichen Dienst des Bundes
5.1.b Frauen in Aufsichtsräten der börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen
Der Indikator stellt den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien mit mehr als 2 000 Beschäftigten sowie von Europäischen Gesellschaften (Societas Europaea, SE) und börsennotierten Unternehmen dar, die der paritätischen Mitbestimmung unterliegen. Datengrundlage ist die Auswertung der veröffentlichten Angaben dieser Unternehmen durch den Verein Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR), die im sogenannten Women-on-Board-Index (WOB-Index) veröffentlicht wird.
Seit Inkrafttreten des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen im Jahr 2016 müssen mindestens 30 % der neu zu besetzenden Aufsichtsratsposten in börsennotierten und zugleich paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit Frauen besetzt werden. In der im selben Jahr aktualisierten Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wurde darüber hinaus das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2025 mindestens 30 % aller – also nicht nur neu zu besetzender – Aufsichtsratspositionen in diesen Unternehmen mit Frauen zu besetzen. Dieses Ziel wurde bereits im Jahr 2018 mit einem Anteil von 30,9 % erreicht.
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2025 wurde das Ziel auf einen Frauenanteil von mindestens 40 % bis zum Jahr 2030 angehoben. Im Januar 2025 lag der Anteil bei 38,6 % (zum Vergleich: Januar 2015: 21,3 %). Bei Fortsetzung der Entwicklung der letzten Jahre wird das Ziel bereits deutlich vor dem Jahr 2030 erreicht werden. Es ist zu beachten, dass nur ein begrenzter Teil der Unternehmen und Führungspositionen in der Wirtschaft durch diesen Indikator erfasst wird. Aktuell umfasst der Berichtskreis lediglich rund 100 Unternehmen.
Die etwa 1 600 bislang von FidAR betrachteten Aufsichtsratsposten stellen im Vergleich zu insgesamt etwa 1 165 000 Führungskräften in der Wirtschaft (laut Verdienststrukturerhebung 2024) nur einen kleinen Ausschnitt dar. Gemäß der „Internationalen Standardklassifikation der Berufe“ (ISCO) zählen zu den Führungskräften alle Personen, die die Gesamtaktivitäten von Unternehmen, Behörden oder sonstigen Organisationen beziehungsweise ihrer internen Organisationseinheiten planen, steuern, koordinieren und bewerten – einschließlich der Mitglieder von Aufsichtsräten.
Nach dieser Definition waren im Jahr 2024 von den insgesamt 1 165 000 Führungspositionen in der Wirtschaft 27 % mit Frauen besetzt – ein Anstieg um 6,4 Prozentpunkte gegenüber 2014. Berücksichtigt wurden dabei alle Betriebe mit mindestens einer sozialversicherungspflichtig beschäftigten Person, ausgenommen der Wirtschaftsabschnitt O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung sowie teilweise der Wirtschaftsabschnitt P Erziehung und Unterricht.
5.1.c Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst des Bundes
Als einer der größten Arbeitgeber Deutschlands hat sich der Bund mit dem am 21. August 2021 in Kraft getretenen Zweiten Führungspositionengesetz (FüPoG II) das Ziel gesetzt, bis 2025 eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Führungspositionen zu erreichen.
Der Indikator bezieht sich auf alle voll- und teilzeitbeschäftigten Personen sowie auf Beschäftigte, die aufgrund familiärer Betreuungs- oder Pflegeaufgaben beurlaubt oder vollständig freigestellt sind. Erfasst werden die obersten Bundesbehörden, ihre nachgeordneten Behörden sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts des Bundes.
Bis zum Jahr 2022 basierte der Indikator auf einer Sonderauswertung der nicht veröffentlichten Gleichstellungsstatistik des Bundes gemäß den Vorgaben des Bundesgleichstellungsgesetzes (BGleiG). Das Statistische Bundesamt führt diese Statistik seit 2015 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) alle zwei Jahre zum Stichtag 30. Juni durch.
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Maßnahmenprogramms Nachhaltigkeit wurde die Gleichstellungsstatistik im Jahr 2021 erweitert: Seit dem 30. Juni 2022 erfassen die obersten Bundesbehörden zur Jahresmitte auch für ihre nachgeordneten Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung die Anzahl der Frauen und Männer in Führungspositionen sowie die prozentuale Teilhabe.
Gemäß § 3 der Gleichstellungsstatistikverordnung (GleiStatV) umfasst der Begriff Führungspersonal Personen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben in den Dienststellen des Bundes. In den obersten Bundesbehörden handelt es sich dabei in der Regel um Beschäftigte des höheren Dienstes – von Referatsleitungen bis zu Staatssekretärinnen und Staatssekretären. In anderen Bundesdienststellen können Führungsaufgaben auch von Beschäftigten des gehobenen oder mittleren Dienstes wahrgenommen werden. Um die Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen, werden im Indikator jedoch ausschließlich Personen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben im höheren Dienst berücksichtigt – unabhängig davon, ob in einzelnen Ressorts auch andere Dienstebenen entsprechende Aufgaben wahrnehmen. Damit weicht die Definition von Führungspositionen in der Gleichstellungsstatistik und im Monitoring der obersten Bundesbehörden von der ISCO-Klassifikation ab, auf der Indikator 5.1.b basiert. Ein direkter Vergleich beider Indikatoren ist daher nur eingeschränkt möglich.
Im Jahr 2024 lag der Anteil von Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst des Bundes bei 46,5 % – gegenüber 19,5 % im Jahr 2000. Damit hat sich der Anteil seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Bei Fortsetzung der Entwicklung der letzten sechs Berichtsjahre würde das politisch festgelegte Ziel der gleichberechtigten Teilhabe – also annähernde numerische Gleichheit – bis 2025 erreicht werden.
In den obersten Bundesbehörden lag der Anteil von Frauen in Führungspositionen 2024 bei 44,7 % und damit etwas niedriger als in den nachgeordneten Behörden (46,7 %). Den höchsten Frauenanteil wies mit 67,2 % das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) auf (60,4 % in den nachgeordneten Behörden). Es folgte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung mit 55,2 %. Den geringsten Anteil verzeichnete das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) mit 36,5 % in der obersten Behörde und 29,6 % in den nachgeordneten Behörden.